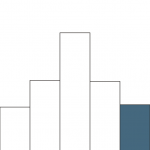Gewalttätige Hausbesetzer in Berlin – Die Linken und der Kiezterror

Die Rigaer Straße in Berlin ist seit Jahren ein Zentrum der Gewalt. Nun soll dort ein besetztes Haus geräumt werden. Die Polizei rüstet sich für eine Eskalation.
Von Roman Lehberger und Ansgar Siemens
Als Torsten Luschnat das Haus betreten wollte, standen Vermummte am Eingangstor. Der Verwalter wusste, dass man ihn als Eindringling sah. Er hatte einen Anwalt mitgebracht. „Wir haben gesagt, dass wir keinen Streit wollen“, erinnert sich Luschnat, „aber ein Gespräch war nicht möglich.“
Die beiden Männer machten kehrt, doch zu spät. Zehn bis zwölf Angreifer, so Luschnat, warfen ihn zu Boden, traten ihn mit Füßen und schlugen ihn mit einem Teleskopschlagstock. Dem Anwalt sprühten sie Reizgas ins Gesicht. Erst als mehrere Streifenwagen kamen, verschwanden die Täter im Haus. Gefasst wurde niemand. Die Polizei bestätigt die Attacke aus dem Juli.
Berlin, Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Seit Jahren sind zwei zum Teil besetzte Häuser in dem Viertel das Symbol schlechthin für die autonome Szene der Hauptstadt: das Haus Rigaer Straße 94, Abkürzung R94, vor dem Luschnat und der Anwalt Gewalt erlitten. Und die Liebigstraße 34, kurz L34, eine Ecke weiter. Von den Balkonen wehen Banner, überall prangen Parolen: „Fight Sexism“ und „Smash Patriarchy“.
Die Radikalen betrachten den Straßenzug als ihren Kiez. Von Dächern fliegen Steine auf Polizisten, Autos werden in Brand gesteckt. Auf der Kreuzung zünden Autonome Lagerfeuer an, sie nennen diesen Ort ihren „Dorfplatz“.
Die Rigaer ist eine Herzkammer der deutschen Autonomen, eines Milieus, dessen zunehmende Militanz Beamte extrem besorgt. In einer Analyse des Verfassungsschutzes heißt es, ein „harter Kern“ radikalisiere sich zusehends. Es bestünde „die Gefahr eines neuen Linksterrorismus“.
Längst ist in der Rigaer Straße ein Kleinkrieg im Gange. Er trifft vor allem Nachbarn, aber auch Polizisten und Journalisten. Weil die Gewalt im Viertel im vergangenen Jahr stark zunahm, gründete die Polizei eine eigene Ermittlungsgruppe – mit mäßigem Erfolg. „Zu fassen kriegen wir kaum jemanden“, sagt ein Fahnder.
Politiker wirken hilflos, Anwohner fühlen sich ausgeliefert. Jetzt dürfte die Lage eskalieren. Der Eigentümer will das Haus L34 Anfang Oktober räumen lassen. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor, Staatsschützer prognostizieren einen „heißen Herbst“. Eine Konfrontation zwischen Staat und Bewohnern lässt sich wohl nicht mehr verhindern.
Der Konflikt um die Rigaer Straße erzählt viel über Berlin, über seine chaotische Politik, die glücklose Rolle der Polizei und eine Ignoranz für Gewalt, wenn sie von links kommt.
Die Nachbarn
Wenn Silke Konrad, die in Wahrheit anders heißt, das Haus verlässt, schaut sie sich um. Sie hat inzwischen ein mulmiges Gefühl auf der Straße. „Man kann nie wissen, was einen erwartet“, sagt sie.
Die Mutter eines Pflegekindes wohnt in einem Neubaukomplex, nur einen Steinwurf entfernt von den besetzten Häusern.
In einer Nacht im vergangenen Oktober habe die 43-Jährige auf ihrem Balkon eine Zigarette geraucht, wie sie sagt. Da habe sie gesehen, dass drei Frauen die Fassade ihres Hauses besprühten. Konrad sei nach unten gehastet und habe eine Frau festgehalten.
„Ich sagte, dass sie das bitte wieder wegmachen sollen, sonst würde ich eine Anzeige erstatten“, so Konrad. Hysterisch hätten die Frauen geschrien, sich losgerissen, seien weggerannt. Nach einer kurzen Flucht seien sie vor den Augen herbeieilender Polizisten in die L34 geflüchtet.
„Yuppie-Schweine, Schüsse in die Beine“ und „Rache“ sprühte jemand in der nächsten Nacht an Konrads Haus. Als sie später vor die Tür trat, sei eine der Bewohnerinnen aus der L34 auf sie zugestürmt und habe sie an der Schulter gepackt. „Sie wüssten jetzt, wer ich sei und wo ich wohnte. Sie sagte auch sinngemäß, ich hätte keine ruhige Nacht mehr“, so Konrad.
Wie sie von Augenzeugen erfuhr, hatten mehrere Frauen aus der L34 ihre Haustür observiert und gewartet, bis sie herauskam. „Die machen einen fertig“, sagt sie.
Man muss sich den autonomen Nachbarn nicht erst in den Weg stellen, um zur Zielscheibe zu werden. Der Neubaukomplex, bestehend aus etwa 200 Wohnungen, wird seit Jahren attackiert.
Ein warmer Nachmittag Ende August. Im Innenhof der Wohnanlage spielen Kinder in einem Sandkasten. An einer Leine zwischen den Gebäuden hängen zwei Regenbogenflaggen. Neun Anwohner sitzen in einem Stuhlkreis und berichten von den Angriffen, deren Spuren nicht zu übersehen sind. In einigen Scheiben im Erdgeschoss klaffen noch die Löcher, die Stahlkugeln gerissen haben, geschossen offenbar aus einer Schleuder.
Die Angriffe variieren. Mal sind es Schmierereien an der Fassade, mal werden Fäkalien oder Farbbeutel geworfen. Auch Flaschen und Steine kamen zum Einsatz. Silke Konrads Mann wurde auf der Straße angespuckt. „Fickt euch!“, hat jemand in Blau neben eine Haustür gesprüht. Der Schriftzug „L34“ prangt an der Wand.
„Im Schnitt haben wir mindestens einen Übergriff im Monat“, sagt Kaspar Deecke, Ex-Fotograf und heute Hausmeister. Weit mehr als hundert Fensterscheiben seien seit 2015 zu Bruch gegangen, viele noch in der Bauphase.
Dabei wohnen in dem Komplex gar keine neureichen Yuppies, sondern sehr bodenständige Leute. Um den zunehmend hohen Mieten in Berlin zu entkommen, schlossen sich Dutzende Menschen zusammen und errichteten auf einer Brache an der Rigaer Straße neuen Wohnraum. Jeder brachte seine Ersparnisse ein.
Noch bevor die ersten Wohnungen bezugsfertig waren, sei das Auto eines Security-Mannes in Flammen aufgegangen. Kurz nach dem Einzug von Deecke seien innerhalb einer Woche 24 Stahlkugeln auf eines der Fenster geprasselt. Seine damals 14-jährige Tochter habe dahinter geschlafen. 13 der sechs Millimeter dicken Projektile seien im Zimmer gelandet. So erzählt er es.
„Wir haben eine Grundsympathie für die Hausbesetzer“, sagt Deecke. „Aber das ist mafiöses Verhalten. Die Autonomen wollen die Regeln bestimmen. Die, die ihrer Ansicht nach nicht hierherpassen, werden terrorisiert.“
Die meisten im Stuhlkreis stehen politisch links. Einer ist Projektmanager für erneuerbare Energien, eine Grundschullehrerin, Rentnerinnen der Alt-68er-Generation sind unter ihnen, eine Sonderschulpädagogin gehört dazu. Häufig hätten sie das Gespräch mit den Autonomen gesucht. Ohne Erfolg. „Sie sind nicht zugänglich für irgendein Friedensangebot“, sagt Deecke. „Wir versuchen es aber ganz masochistisch weiter. Wir wollen nicht, dass ihre Häuser geräumt werden. Wir haben nur die Schnauze voll von der Gewalt.“
Viele in der Nachbarschaft haben Angst vor den Extremisten. Vor zwei Jahren bekam ein Ehepaar ein paar Hundert Meter weiter Tag und Nacht Polizeischutz. Die Frau hatte den Fehler gemacht, Krankenwagen und Polizei zu rufen, als ein bekannter Gewalttäter aus der R94 einen Passanten während eines Streits auf der Straße fast bewusstlos schlug.
Der Passant kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Vor Gericht sagte die Anwohnerin als Zeugin aus. Daraufhin wurden die Frau und ihr Ehemann auf Flugblättern als „Kollaborateure“ des verhassten Staates beschimpft. Ein Rädelsführer der R94 veranstaltete Kundgebungen gegen das Paar. Ende 2018 zogen die Verunglimpften weg. Der Mob hatte gesiegt.
Und die Bezirksbürgermeisterin? Gelächter im Stuhlkreis. Die Nachbarn fühlen sich von Monika Herrmann (Grüne) im Stich gelassen. „Der Bezirk solidarisiert sich mit den Hausbesetzern“, sagt Anwohnerin Konrad. „Und wer schützt uns?“
Die Politik
Um die Lage zu verstehen, hilft ein Blick auf die Verhältnisse. Friedrichshain-Kreuzberg ist eine grüne Hochburg. Von hier stammt die einzige Grüne mit einem Direktmandat im Bundestag. Auch in der Lokalverwaltung geben die Grünen zusammen mit den Linken den Ton an. Geht es um militante Autonome, versucht man einen Spagat: Sympathie für Hausbesetzer, Distanzierung von Gewalt.
Manchmal wird der Terror im Kiez gar komplett ausgeblendet. Zum Beispiel in der Resolution DS/1699/V, die im Juni auf Antrag der Grünen und Linken in der Bezirksverordnetenversammlung beschlossen wurde. Im Hinblick auf die geplante Räumung der L34 sicherte man den Autonomen volle Unterstützung zu. Das besetzte Haus sei ein „einzigartiger Schutzraum“, eine Anlaufstelle für diskriminierungserfahrene Menschen, heißt es in dem Papier. Mit seinem „solidarischen Kiezbezug“ und seiner „Widerständigkeit“ präge das Haus das Viertel. Es sei gar nicht mehr wegzudenken, so die Resolution.
Die Nachbarn aus den attackierten Neubauten reagierten mit einem Protestbrief an Bürgermeisterin Herrmann, inklusive Fotos der Beschädigungen.
Den Protestbrief schickten die Nachbarn auch an ihre Vertreterin im Bundestag, die Abgeordnete Canan Bayram. Die Rechtsanwältin ist Nachfolgerin des grünen Parteilinken Hans-Christian Ströbele und so etwas wie die Stimme der Hausbesetzer im deutschen Parlament. Schuld an Eskalationen haben aus Bayrams Sicht eher der Berliner Innensenator und dessen Polizei. Die Beamten schikanierten die Anwohner, twitterte Bayram einmal. Gibt es mal wieder einen Einsatz gegen die Szene, ist die Grüne oft zur Stelle. „Bei uns war sie noch nie“, sagt Hausmeister Deecke.
Mehrere schriftliche und telefonische Gesprächsanfragen des SPIEGEL an Bayram verliefen ergebnislos. An einem Freitagnachmittag Anfang September steht sie auf einer Wiese in Friedrichshain unter zwei Sonnenschirmen. Die Grünen haben zum Thema Familienpolitik eingeladen. „Dass Sie mich hier jetzt versuchen zu stellen, ist nicht gerade feiner Stil“, blafft Bayram die Reporter an. Über die Rigaer Straße wolle sie nicht sprechen. Sie habe andere Prioritäten.
Die Berliner Landesregierung kann nicht so wählerisch sein. Das Problem Rigaer Straße wird von Wahl zu Wahl weitervererbt – eine Art Berliner Flughafen für Innensenatoren. Der vorläufig letzte CDU-Mann im Job, Frank Henkel, versuchte sich als Hardliner. Auf dünnem juristischem Eis schickte er seine Hundertschaften 2016 zur Teilräumung in die R94.
Es folgten Ausschreitungen und eine juristische Niederlage für den Eigentümer. Die Räumung sei illegal gewesen, urteilte das Landgericht. Kurz darauf war Henkel weg, die Autonomen triumphierten. Seit vier Jahren sitzt nun Andreas Geisel (SPD) im Sattel. Er wolle kein „Sheriff“ sein, sagt er, er handele rechtsstaatlich. CDU-Oppositionsführer Burkard Dregger wirft ihm dagegen „zu viel Rücksicht“ vor. „Er tut nicht, was er tun könnte, um Recht und Ordnung durchzusetzen.“
Andreas Geisel empfängt in seinem Büro. „Ein einziger Mist“ sei die Situation, sagt er. „Es mangelt mir aber nicht an Entschlossenheit, Recht und Ordnung durchzusetzen.“ Jeder Durchsuchungsbeschluss werde vollstreckt. Straftäter, wenn möglich, verfolgt. „Wenn Vermummte in ein verbarrikadiertes Haus mit vielen Wohnungen flüchten und völlig unklar ist, in welche Wohnung sie konkret geflüchtet sind, stößt man an Grenzen“, sagt Geisel. „Wir können nicht überall mit der Ramme rein nach Wildwestmanier.“
Für Solidaritätsbekundungen mit den Hausbesetzern hat Geisel wenig Verständnis. In Regierungskreisen glaubt man, die Bezirksverwaltung könne mehr tun, um Vorschriften durchzusetzen. Etwa bei der Kontrolle der „Kadterschmiede“, einer inoffiziellen Kneipe im besetzten Teil der R94. Oder in der Bauaufsicht.
„Wir sind in Gesprächen mit dem Bezirk“, sagt Geisel. Eine Lösung könne es aber nur mit dem Eigentümer des Hauses geben. „Im Moment haben wir es mit einer Briefkastenfirma zu tun“, so Geisel. Zur Not könnte die Stadt die Immobilie kaufen. „Aber solange die Firma ihren Hintermann nicht benennt, geht das nicht.“
Die Eigentümer
Berlin, Potsdamer Platz, Konferenzraum einer Wirtschaftskanzlei. Sonne fällt durch die hohen Fenster im vierten Stock. Am Tisch sitzt, neben zwei Anwälten, ein Phantom. Ein Mann in türkisfarbenem T-Shirt, der leise spricht und seinen Namen nicht verbreitet sehen will. Investor kann man ihn nennen. Er sagt, er habe Angst vor Angriffen.
2014 habe er die R94 gekauft. Vorderhaus, linker Seitenflügel, Hinterhaus, insgesamt 30 Wohnungen. Preis: Berichten zufolge 1,2 Millionen Euro. Ein Schnäppchen, so klingt es. Der Investor bestätigt die Zahl nicht. „Der Vorbesitzer ist mehrfach körperlich attackiert worden, deshalb wollte er das Haus verkaufen.“
Der Investor kannte die Geschichte der R94 vorher, „natürlich“. Vor 30 Jahren, kurz nach dem Mauerfall, wurde die damals leer stehende Immobilie besetzt, es wuchs ein linksalternatives Hausprojekt. Anfang der Neunziger schloss eine städtische Wohnungsbaugesellschaft Mietverträge mit den Bewohnern ab – zu günstigen Konditionen.
Der Frieden hielt nur wenige Jahre, die Eigentümer wechselten, es gab Streit um Verträge, Räumungen, erneute Besetzungen, Straßenschlachten. 2013 wollte eine Stiftung das Haus kaufen und den Bewohnern günstig überschreiben. Die Bewohner entschieden sich dennoch „für die Fortsetzung des Kampfes und gegen die Befriedung“, so steht es auf ihrer Homepage.
Was will man mit so einem Haus? Der Investor zieht an einer E-Zigarette. Mietverhältnisse legalisieren und auf normalen Standard bringen, besonders im Hinterhaus, das sei sein Ziel gewesen, sagt er mit ruhiger Stimme.
Ein bisschen renovieren, ein bisschen instand setzen. Dafür sollte die Kaltmiete pro Quadratmeter im Vorderhaus auf 7 Euro im Schnitt steigen, im Hinterhaus auf 3,50 Euro. Dort liegt der Preis bisher bei 1,20 Euro – sofern gezahlt wird.
„Sechs bis sieben Prozent Rendite pro Jahr“ habe er angestrebt, sagt der Investor, nach Abzug der Kosten. Geld verdienen, klar. Aber keine Luxuswohnungen. Er sei „Bestandsimmobilienhalter“, beteuert er. „Ich ging davon aus, dass man die Situation langfristig befrieden könnte.“ Was man in der Rigaer 94 sehe, „kann doch kein Dauerzustand sein“.
Der Plan ging nicht auf. Der erste Hausverwalter, der beauftragt wurde, habe Besuch von Vermummten bekommen – und aufgegeben. Zwei Anwälte wurden bedroht. Den Leuten, die Wohnungen besetzt hielten, bot man Mietverträge an, wie geplant. Der Gegenvorschlag sei gewesen, so der Investor: ein Euro pro Quadratmeter. Plus der Bedingung, dass die Polizei keinen Zutritt bekäme.
Unterlagen zufolge, die der SPIEGEL einsehen konnte, sind heute nur 5 Wohnungen ordnungsgemäß vermietet. Für 15 weitere Wohnungen überweist eine Frau die Miete. Grundlage dafür sind Altverträge mit Leuten, die längst woanders leben. 10 Wohnungen gelten als besetzt.
Die Lage ist inzwischen so festgefahren, dass sie dem Investor kaum mehr lösbar erscheint. Um sich zu schützen, sagt er, müsse er sich hinter einem Geflecht aus britischen Tarnfirmen verbergen. Doch das macht ihn handlungsunfähig.
Eigentümerin der R94 ist die eigens gegründete Lafone Investments Limited aus Consett im Nordosten Englands, Heimat des als „Mr. Bean“ bekannt gewordenen Komikers Rowan Atkinson.
Das Unternehmen klagte auf Räumung einzelner Wohnungen, auf Räumung der „Kadterschmiede“, klagte darauf, dass der Verwalter das Haus überhaupt betreten darf. Vergebens. Im jüngsten Beschluss Mitte August teilte das Landgericht Berlin zum wiederholten Mal mit, der vorgebliche Direktor der Lafone könne seine Prokura nicht beweisen. Und so fühlen sich Bewohner offenbar bestätigt, dem Verwalter den Zutritt zu verwehren.
Das Problem ist, dass hinter der Lafone weitere Briefkastenfirmen stehen. Es ist wie bei einer Matroschka-Puppe: Zum Vorschein kommen stets nur neue Strohleute. Der Investor bleibt verborgen.
Wenn die Zustände so bleiben, wolle er das Haus wieder loswerden, sagt er. Es koste ihn jeden Monat Geld, „8000 bis 9000 Euro“, weil die Lafone auf Nebenkosten sitzen bleibe, Prozesskosten habe, den Hausverwalter bezahlen müsse. Nur 3500 Euro kämen an Miete rein. Das sei „auf Dauer nicht zu verkraften“. Kaufen solle das Land Berlin. Zu welchem Preis?
Der Investor lächelt jetzt und denkt kurz nach. Die Zahl, die er sagt, will er später nicht veröffentlicht sehen. Nur so viel: Der Marktwert eines unbesetzten Hauses in dieser Lage betrage knapp sechs Millionen Euro. Er sei bereit, „deutlich unter diesem Verkehrswert“ zu verkaufen.
Der Investor erhöht jetzt den Druck. Vor wenigen Wochen haben seine Anwälte eine erneute Räumungsklage gegen die „Kadterschmiede“ eingereicht. Diesmal sollen neue Dokumente beweisen, wer in der Lafone das Sagen hat. Zudem legten sie der Stadt ein aktualisiertes Nutzungskonzept vor. Man wolle sämtliche besetzten Wohnungen räumen, um sie danach als Sozialwohnungen zu vermieten. Im Vorderhaus soll eine Kita einziehen.
Dem Bezirksamt drohen die Anwälte mit einer Untätigkeitsklage. Es gebe Brandschutzmängel im Haus, die der Hausverwalter nicht beseitigen könne, weil er keinen Zutritt habe. Der Bezirk sei in der Pflicht einzuschreiten. Außerdem habe die Kneipe keine Schanklizenz.
Wer die Geschichte von Gijora Padovicz kennt, kann verstehen, warum der Investor seine Identität verschleiert.
Padovicz gehört die L34. Das Haus ist von Frauen eines „anarcha-queer-feministischen Projekts“ besetzt. Ende August hat das Landgericht entschieden, dass Padovicz räumen lassen darf. Am 9. Oktober soll es so weit sein. Außerdem müssen die Bewohnerinnen etwa 20 000 Euro Nebenkosten nachzahlen.
Padovicz möchte wegen der angespannten Lage nicht über die Sache sprechen. Stattdessen empfängt sein Anwalt Ferdinand Wrobel in seinem Büro, vor der Tür stehen zwei Polizisten. „Aufgrund der Bedrohungslage“, sagt Wrobel.
Im Januar zerstörten Unbekannte nachts das Auto des Juristen. In einem Bekennerschreiben hieß es, Wrobel mache die „Drecksarbeit für eines der größten Immoarschlöcher der Stadt“ und verdiene sein Geld „auf dem Rücken der MieterInnen“. Er sei Teil einer „kapitalistischen Verdrängungsmaschinerie“.
Dabei hatte es für Jahre kaum Konflikte um die Liebig 34 gegeben. 2008 hatte Padovicz das Haus gekauft, Berichten zufolge für etwa 600 000 Euro. Er schloss mit den Bewohnerinnen einen Pachtvertrag, befristet auf zehn Jahre und zu extrem günstigen Konditionen: Für das Haus zahlten sie zunächst 4022,50 Euro pro Monat plus Nebenkosten, später 4807,32 Euro. Es handele sich um etwa 30 Wohneinheiten, genau wisse man das nicht, sagt Anwalt Wrobel. „Der Eigentümer hat seit Jahren keinen Zutritt zum Haus.“ Es habe offenbar Umbauten gegeben.
Der Vertrag für die L34 lief am 31. Dezember 2018 aus. Die Bewohnerinnen sollten gehen. Aber sie gingen nicht. Stattdessen gab es eine Serie von Angriffen auf Padovicz und seine Leute.
Auf Twitter verbreiteten die Bewohnerinnen der L34 ein Foto, auf dem Vermummte zu sehen sind, die mit einem Transparent posieren. Darauf steht: „Padovicz aus der Traum! Bald liegst du im Kofferraum!“ Eine kaum verhohlene Anspielung auf den Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer, der 1977 von der RAF ermordet wurde.
Die Bewohner
Jan Kasiske hat ein Herz für die Hausbesetzer aus der Rigaer Straße. „Das Feindbild des Linksautonomen gibt es in meinem Weltbild nicht“, sagt der Ex-Bewohner. Zwischen 2006 und 2011 hat der heute 49-Jährige im Vorderhaus der R94 gelebt, mit Mietvertrag. Sein Sohn wohnt immer noch dort. Früher machte Kasiske Präventionsarbeit gegen Rechtsextremismus. Heute coacht er Führungskräfte.
„Mit dem Hinterhaus hatten wir uns verständigt“, so Kasiske. „Damals war die Situation auch noch nicht so wie heute. Es wurde viel um den richtigen Weg gerungen.“ Straftaten und Gewalt sind für ihn eine rote Linie. Dafür gebe es keine Rechtfertigung, „von keiner Seite“. Einige aus dem Haus seien für vernünftige Lösungen wohl inzwischen nicht mehr erreichbar. Generell aber müsse ein Biotop wie die R94 als Ausdruck linker Lebenskultur in einer Demokratie möglich sein. „Aber wenn ich in einem ruhigen Stadtteil leben will, ziehe ich nicht in die Rigaer.“
J. B. gehört eher nicht zu denen, die es ruhig mögen. „Rädelsführer“, „Gewalttäter Links“, „maßgebender Teil der linksextremistischen Szene“ – so beschreiben Staatsschützer den gebürtigen Rosenheimer in vertraulichen Akten.
„Wir vermuten ihn hinter vielen Aktionen und Straftaten, die in der R94 ihren Ursprung haben“, sagt ein Beamter einer Sicherheitsbehörde. Nicht alle Bewohner seien Extremisten. Vor allem im Vorderhaus lebten Personen, die wohl mit der Szene sympathisierten, aber nicht militant seien, heißt es.
J. B. wohnt im Hinterhaus. Die „Fraktion Hardcore“, so nennt ein Ermittler den Gebäudeteil. Mit den militanten Feministinnen aus der L34 gebe es einen regen Austausch. Polizisten gehören für den harten Kern der Autonomen genauso zum Feindbild wie Journalisten. Kamerateams werden attackiert, Reporter nach kritischen Berichten im Internet denunziert. Einem Kolumnisten, der immer wieder über die Rigaer berichtet, fackelten Unbekannte zweimal vor seiner Wohnung das Auto ab.
J. B. gehört zu den Veteranen. Er sei intelligent, ein Anführer, autoritär, kompromisslos in seiner Ablehnung des Staats, sagt ein Beamter. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt gegen zwei Gefährten von B., weil sie dem Jobcenter gefälschte Dokumente vorgelegt und Sozialleistungen erschlichen haben sollen. Seit vergangenem Jahr wird nach J. B. gefahndet. Wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung muss er eine DNA-Probe abgeben. Erwischt hat man ihn noch nicht.
Zu unübersichtlich ist die Lage in der R94 mit ihren geschätzt rund 50 Bewohnern, zu mobil der Verdächtige. Er pflegt enge Kontakte in die militante Szene im Ausland, nach Griechenland zum Beispiel.
Eine Anfrage des SPIEGEL ließ J. B. unbeantwortet. Ein Anwalt, der Bewohner der R94 vertritt, wollte sich ebenfalls nicht äußern.
In Sicherheitskreisen gilt B. als anschauliches Beispiel für die zunehmende Radikalisierung der Autonomen, deren Rückzugsorte im umkämpften Immobilienmarkt immer mehr verschwinden. Nach Angaben der Berliner Innenverwaltung wurden im Umkreis der R94 und L34 in den vergangenen vier Jahren 330 private Fahrzeuge und 48 Streifenwagen beschädigt. Hinzu kamen Dutzende verletzte Beamte und zahlreiche Sachbeschädigungen und Brandstiftungen an Gebäuden. „Bei diesen Extremisten verkommt der linke Kampf für eine gerechte Welt zur Besitzstandswahrung mit militanten Mitteln“, sagt der SPD-Innenpolitiker Tom Schreiber. „Sie reden immer von einer größeren Sache. Letztlich dreht sich aber alles immer nur um ihr kleines Milieu.“
Die Polizei
Wer zu Kriminalrat Jens Müller will, muss vor dem Eingang warten, bis er abgeholt wird. Ein grauer Betonkasten in Berlin-Tempelhof. Müllers echter Name ist tabu. Zu groß ist für ihn die Gefahr, ins Visier seiner Kundschaft zu geraten.
Seit einem Jahr ist der 43-Jährige leitender Ermittler im Landeskriminalamt, zuständig für den Komplex Rigaer Straße. Doch sein Büro ist noch immer ein Provisorium, als wäre er schon auf dem Sprung. In zwei Jahren wird er als Karrierebeamter des höheren Dienstes in die nächste Abteilung wechseln.
Mit der Rigaer lässt sich nur wenig gewinnen. Dafür muss die Polizei sich immer wieder Vorwürfe anhören. Die Rigaer Straße sei nur deswegen ein Brennpunkt, weil die Polizei dort immer wieder provoziere, sagt ein Kenner der Szene. Polizeigewerkschafter sprechen dagegen von „menschenverachtender Gewalt“ gegen Beamte. „Es ist oft nur der Schutzausrüstung oder dem bloßen Zufall zu verdanken, dass etwa Angriffe mit Steinen von Dächern nicht tödlich für die Kollegen enden“, so Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin.
Die Kripo-Ermittler von Jens Müller versuchen, linksextreme Straftäter zu überführen, die sich in den besetzten Häusern und deren Umfeld bewegen. Müller sagt, die R94 sei „Schaltzentrale“ und „Widerstandssymbol“ der Szene, weit über Berlin hinaus. Das Hauptproblem seien ein paar Dutzend Extremisten, die sich regelrecht verschanzt hätten. Sie hätten eine eigene „Gebäudesicherung“ vorgenommen. Zugänge seien zugemauert, Falltüren installiert worden.
Wie schwer sich die Polizei mit der Rigaer tut, zeigt ein „Entscheidungsvorbehalt“ der Polizeipräsidentin, den es in abgewandelter Form schon seit 2012 gibt. Er macht es nahezu unmöglich, Verdächtige zu verfolgen, die in „linke Szeneobjekte“ fliehen. In solchen Situationen, so heißt es in dem Dokument, müsse zunächst ein Vorgesetzter in der Direktion um Erlaubnis gefragt werden. Und bis das geschehen ist, sind die Flüchtigen längst weg.
Hinter vorgehaltener Hand beklagen Polizisten eine ausgeprägte Nachsicht der Behörden mit den Autonomen. Wenn J.B. „ein Nazi wäre“, sagt ein Beamter sehr überzeugt, „dann säße er schon längst im Knast“.